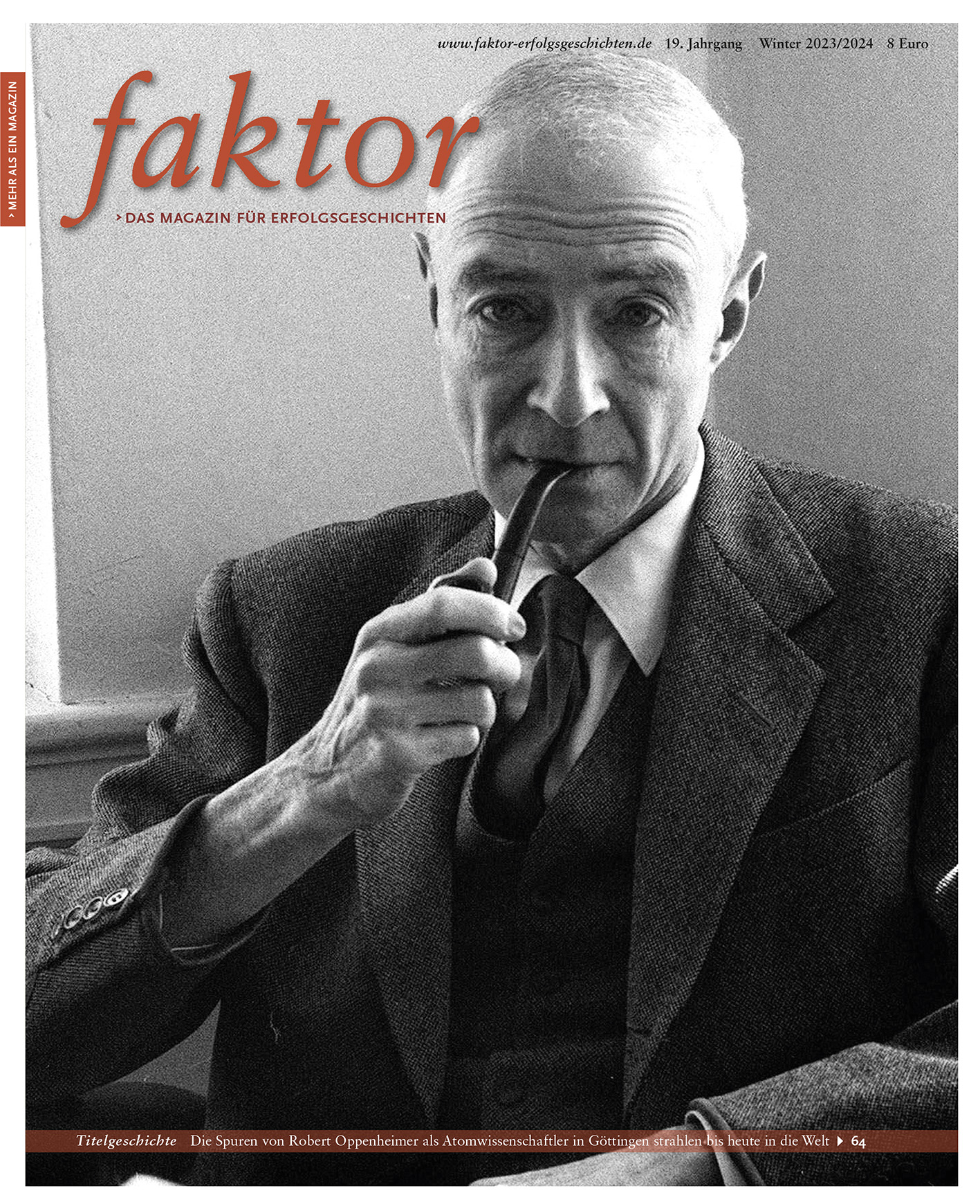Sybil Gräfin Schönfeldt, aufgewachsen in Göttingen, erzählt in ihrem neuen Buch und im Interview von ihrer ganz eigene Ansicht, was der Begriff Heimat bedeutet.
87 Jahre – Sybil Gräfin Schönfeldt blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, das sie an viele Orte geführt hat. Sie wird als vermeintliche Waise in Nassau großgezogen, verbringt ihre Schulzeit in Göttingen und entdeckt erst im Laufe der Zeit über die Großeltern und ihren Vater – der ohne seine Tochter sein eigenes Leben führt – in welch weit verzweigte und traditionsreiche Familie sie doch gehört. Ihre Wurzeln finden sich auf den Philippinen, in Österreich, Italien und Deutschland. Ihre Verwandten sind weltweit zuhause.
Gräfin Schönfeldt, was fällt Ihnen als erstes zum Begriff ‚Heimat‘ ein?
Nun, im Allgemeinen sagt man ‚ubibene, ibipatria‘, übersetzt: ‚Wo es schön ist, ist die Heimat.‘. Oft wird der Begriff auch mit dem Ort gleichgesetzt, in dem man die Kindheitsjahre verbrachte.
Sie verbrachten Ihre Kindheit in Nassau an der Lahn. Würden Sie diesen Ort als Ihre Heimat bezeichnen?
Nein. Auch wenn ich dort fünf schöne Kindheitsjahre hatte, so war es doch eine Zufallsheimat. Denn ich kam nach Nassau, einfach weil es sich nach dem Tod meiner Mutter so ergeben hat. Es war ein behütetes Aufwachsen unter vielen Menschen, die sich um mich sorgten. Selbst Vater und Mutter fehlten mir nicht, denn ich fühlte mich geborgen in der großen Dorfgemeinschaft. Aber ich würde Nassau nicht als meine Heimat begreifen. Und leider fiel die 3000-Seelen-Stadt im Zweiten Weltkrieg einem Bombenteppich zum Opfer – so wie ich es kannte, existiert sie nicht mehr.
Mit dem Beginn Ihrer Schulzeit sind Sie zu Ihrer Großmutter nach Göttingen gekommen. Wo haben Sie hier Ihre Zeit verbracht?
Meine Großmutter und ihr zweiter Mann, mein Stiefgroßvater Elli, lebten in einem gemieteten Haus in der Herzberger Landstraße. Ich besuchte die Volksschule, heutige Albanischule, und ging später in das Lyzeum, das heutige Hainberggymnasium, im Friedländer Weg. Mein ‚Revier‘ sozusagen waren die Gärten hinter den Häusern der Herzberger Landstraße. Von den Gärten ging es in die Felder, die vom Hainberg begrenzt waren. Dort haben wir Kinder unsere Zeit verbracht, uns Laubhütten gebaut, unsere eigene Welt gehabt.
Kurz vor Ihrem Abitur wurden sie vom Reichsarbeitsdienst nach Oberschlesien geschickt, sind aber für Ihren Schulabschluss und ein Studium der Germanistik und Kunsthistorie wieder ‚heimgekehrt‘ in die Stadt an der Leine…
…das klingt doch nach einer Idylle.
Und ‚Wo es schön ist, ist die Heimat‘, oder?
Nein, auch das wieder nicht. Ich hatte schon eine Bindung an die Stadt, aber sie ist mir mit den Jahren fremd geworden. Die vielen Abrisse von schönen Gebäuden in den Sechziger Jahren, wie zum Beispiel dem Reitstall und dem gusseisernen Schwimmbad, dann die ganzen Eingemeindungen, die zu einer enormen Einwohnersteigerung führten. Göttingen ist gewachsen und ich bin bei jedem Besuch wieder erstaunt, was es alles Neues gibt. Es gibt viele schöne Erinnerungen, vor allem an Menschen, die mir seit meiner Kindheit vertraut sind, aber kein Heimatgefühl.
Bei Ihnen sind die Orte der Kindheit also offensichtlich nicht mit dem Begriff ‚Heimat‘ verbunden.
Das stimmt. Und ich würde sagen, am ehesten hege ich Heimatgefühle für Österreich. Dort, wohin mich mein Vater während des Studiums geholt hat und wo auch seine Vorfahren gebürtig waren.
Das ist interessant, denn in Wien waren Sie ja nur für wenige Jahre – in Hamburg leben Sie hingegen schon seit vielen Jahren.
Hamburg, ja auch das könnte ich als ,Wohnheimat‘ bezeichnen, seit rund 60 Jahren. Mit Wien verknüpfe ich besondere Erinnerungen. Plötzlich hatte ich zwei Schwestern und einen langersehnten Bruder, mit dem ich viel und über alles reden konnte. Ich hatte, so könnte man sagen, ein richtiges Zuhause mit Geschwistern. Nachdem ich vorher nur bei alten Menschen gelebt hatte, stellte sich bei mir ein völlig neues Lebensgefühl ein. Und so ist mir über die Familie auch die Stadt ans Herz gewachsen. Wenn ich am Josefsplatz bin – in direkter Nachbarschaft zum Lippizanum, der Nationalbibliothek und dem Palais Pallavicini – dann denke ich: Hier gehöre ich hin.
Sie würden also Österreich als Ihre wahre Heimat bezeichnen?
Ja, ich bin Österreicherin, da ist schon ein Heimatgefühl vorhanden. In gewisser Art und Weise aber auch in Hamburg. Es ist nur etwas anders.
Dann schlagen zwei Herzen in Ihrer Brust?
Ach wissen Sie, es sind doch immer die Erfahrungen und auch die Familiengeschichte, die einen an Orte binden. So habe ich auch zu Venedig eine besondere Beziehung, denn durch die Familienhistorie, die viele Generationen zurückreicht, weiß ich Details über diese Stadt, die anderen fremd sind. Das gibt mir genauso ein Gefühl der Verbundenheit. Ebenso wie die Orte in Sachsen, in denen sich Spuren der Schönfeldt-Vorfahren finden.
Fällt Ihnen der Begriff ‚Heimat‘ vielleicht auch so schwer, weil ihre Familie weit verzweigt war bzw. ist: von Italien über Österreich, Deutschland und sogar Manila auf den Philippinen?
Jeder, der in seiner Familiengeschichte nachforscht, wird feststellen, dass es ‚den Heimatort‘ schlichtweg nicht gibt. Die wenigsten stammen seit Generationen aus nur einer Stadt. Ich begreife es so, dass wir eine europäische Heimat haben, in der wir uns zum Glück auch frei bewegen können. Das sollten wir nicht vergessen.
In der heutigen Zeit sind viele Menschen beruflich oft unterwegs, die Arbeitswelt fordert örtliche Flexibilität. Ist denn Heimat heute überhaupt noch wichtig?
Ich denke schon, dass es zumindest einen Ort geben sollte, an dem man sich geborgen fühlt. Was ich für unsere Kultur höchst bedauerlich finde: der Verlust der Väterhäuser. Häuser, die Generationen der Familie gehört haben, seien es Bauern- oder Adelshäuser. Wo nicht fertig Gestricktes der Großmutter von der Enkelin weitergestrickt wird, wo das Spielzeug seinen festen Platz hat und jederzeit wieder hervorgeholt werden kann, wo selbstgewebte Leinenstoffe pfleglich aufbewahrt werden. Unvergessliches. Wer die Gnade hat, so aufwachsen zu können, der hat eine Heimat. Ob er sich mit ihr verbunden fühlt oder nicht. Aber er kann immer wieder dorthin zurückkehren. Heute zieht man ein und aus, kauft sich neue Wohnungen, neue Möbel. Es ist unmodern, alte Möbel zu haben, also schmeißt man sie weg. Heute ist alles austauschbarer, da ist es auch für Kinder schwierig, sich der Familie zugehörig zu fühlen. Wenn ich mich in meinem Zuhause umschaue: Ich habe den Schreibtisch meiner Großmutter, das Bücherregal der Großtante, die Bilder vom Ururgroßvater. Wenn man so etwas um sich hat, ist es leichter, von Heimat zu sprechen. Der Blick auf die Wurzeln der Familie gibt Halt. Auch in Zeiten des Sturms.
Gräfin Schönfeldt, vielen Dank für das Gespräch!